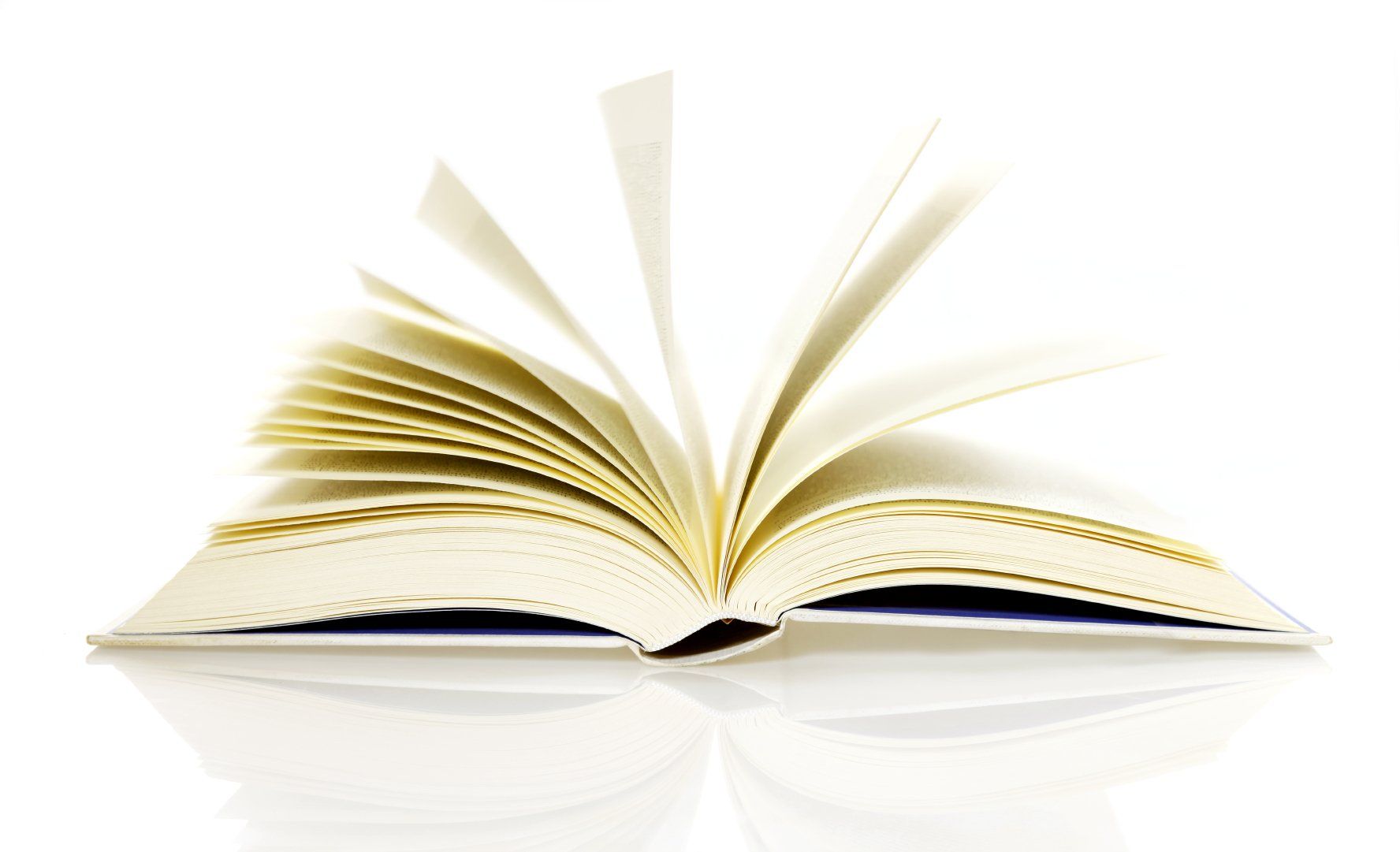Wissenswertes
6,2 Millionen Menschen können laut der neuen Studie nicht richtig lesen und schreiben – sie sind funktionale Analphabeten oder verfügen nur über geringe Literalität. Diese Zahlen hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung gemeinsam mit der Universität Hamburg vorgestellt.
„Die Zahlen sind ernüchternd" sagte GEW-Vorstandsmitglied für Berufliche Bildung und Weiterbildung Ansgar Klinger. „6,2 Millionen Menschen haben noch immer keinen Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe", so Klinger. Von den deutschsprechenden Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 64 Jahren erhöhe sich die Zahl auf 12,1 Prozent. „Für ein Land wie Deutschland, sind das erschreckende Zahlen" sagte Klinger.
Die GEW weist schon seit vielen Jahren auf das Problem hin und skandalisiert die geringe Leistungsbereitschaft von Bund, Ländern und Kommunen zur Verringerung der Analphabetenrate.
Zahl der Demenzkranken wird bis 2050 deutlich steigen
Die Zahl der Demenzerkrankungen könnte in den kommenden Jahrzehnten sprunghaft steigen, heißt es in einem Bericht des Dachverbandes nationaler Alzheimer-Gesellschaften.
Die Zahl der Menschen mit Demenz in Deutschland wird neuen Schätzungen zufolge bis 2050 erheblich steigen. Während 2018 knapp 1,6 Millionen Menschen in der Bundesrepublik mit einer Demenzerkrankung lebten, gehen die Experten von Alzheimer Europe von einem Anstieg auf 2,7 Millionen im Jahr 2050 aus. Deutschland liegt mit dieser erwarteten Entwicklung im europaweiten Trend.
Über die meisten Altersgruppen hinweg erkrankten weniger Männer und auch Frauen an Demenz als noch in vorherigen Hochrechnungen erwartet - der neuen Schätzung zufolge europaweit etwa eine Million Menschen weniger.
"Es ist vielversprechend zu sehen, dass gesündere Lebensstile, bessere Bildung und eine verbesserte Kontrolle von kardiovaskulären Risikofaktoren einen Effekt auf die Häufigkeit von Demenz zu haben scheinen", sagte der Direktor von Alzheimer Europe, Jean Georges, laut Mitteilung.
Allerdings führten das Bevölkerungswachstum in Europa und der demografische Wandel mit immer mehr alten Menschen in vielen europäischen Ländern - wie auch in Deutschland - dazu, dass die Zahl der Demenzkranken insgesamt weiterhin stark ansteigt.
Europaweit werde sich die Zahl der Demenzkranken bis 2050 den Prognosen zufolge verdoppeln.
Speziell für Deutschland sei der steigende Anteil von Menschen über 65 Jahren an der Bevölkerung ein Schlüsselfaktor, dabei insbesondere der Anteil von Menschen, die über 85 Jahre alt sind.
Die erwartete Zahl demenzkranker Menschen werde die Gesundheitssysteme weiter unter Druck setzen, sagte Georges. "Wenn Menschen mit Demenz, deren Familien und Pfleger die hochwertige und individuelle Pflege, die sie benötigen, bekommen sollen, müssen Regierungen ihre Gesundheits- und Pflegesysteme darauf einstellen und mehr in die Forschung zur Behandlung und Prävention von Demenz investieren."
Datenbasis des Berichts waren den Angaben zufolge die aktuellsten Demenz-Studien verschiedener Forschungsgruppen mit den verfügbaren Daten zur Bevölkerung der einzelnen europäischen Länder und den jeweiligen Projektionen für 2025 und 2050.
Life Kinetik Training dient vor allem auch der Demenzvorsorge und Sturzprophylaxe.
Melden Sie sich bei mir für weitere Informationen und zur Kursanmeldung.
Es klingt so banal und kann im Alter doch so entscheidend sein: Wer sich mehr bewegt und mit dem Rauchen aufhört, kann damit auch einer Demenz-Erkrankung vorbeugen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zum ersten Mal entsprechende Leitlinien veröffentlicht. Dabei wies sie auch auf einen Zusammenhang von Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck mit Demenz hin.
Unter Demenz werden verschiedene Erkrankungsformen zusammengefasst, bei denen die geistige Leistungsfähigkeit sehr stark zurückgeht. Die weitaus meisten Betroffenen haben Alzheimer. Erkrankte verlieren innerhalb von Jahren geistige Fähigkeiten und verändern sich in ihrer Persönlichkeit. Die Erkrankung führt in der Regel zu Hilflosigkeit und schwerster Bedürftigkeit sowohl in psychischer als auch in körperlicher Hinsicht. Viele erkennen ihre Angehörigen nicht mehr, manche werden aggressiv.
Dem Vergessen zuvorkommen
1,7 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Alzheimer oder an einer anderen Form der Demenz. Die Ärzte setzen auf Prävention und frühe Intervention.
Den Moment, als das Vergessen begann, erinnert Klaus Kaiser ganz genau. So paradox das klingt. Er und seine Frau hatten sich mit Freunden in einem Restaurant getroffen. „Als die Rechnung kam, konnte ich 330 nicht mehr durch drei teilen”, sagt der ehemalige Finanzberater. „Da war mir klar - bei mir stimmt was nicht.” Vermeintliche Erklärungen fanden sich rasch. Wegen Herzrhythmusstörungen musste Kaiser seit Kurzem Tabletten nehmen. Schon länger hatte er sich „wackelig im Kopf” gefühlt. Auch der Umzug von Mannheim nach München verursachte dem Paar mächtig Stress. Aber die eklatante Rechenschwäche im Restaurant überzeugte den heute 70-Jährigen, eine Gedächtnissprechstunde aufzusuchen.
„Ich fühlte mich, als hätte ich Watte im Kopf”, beschreibt Klaus Kaiser die Irritation. Das ist noch kein Jahr her. Kaiser durchlief eine Reihe von Untersuchungen und Tests. Die Diagnose war eindeutig: Alzheimer. Ein Schock, aber zugleich auch eine Erleichterung. „Wenn man den Feind kennt, kann man ihn bekämpfen”, erklärt Kaiser trotzig.
„Die Früherkennung wird immer wichtiger”, sagt Richard Dodel. Der Neurologe und Alzheimer-Experte leitet an der Universität Duisburg-Essen und am Geriatriezentrum Haus Berge die Gedächtnissprechstunde. „Derzeit konzentrieren wir uns auf Prävention und frühe Intervention.” Gelegentliche Vergesslichkeiten gehören zum Alter, allerdings sind Störungen der Merkfähigkeit, die über einen längeren Zeitraum anhalten und zunehmen, das wichtigste Warnsignal für eine Alzheimer-Erkrankung.
Betroffen sind vor allem Gehirnregionen, die für Gedächtnis, Denken, Sprache und Orientierung zuständig sind: Großhirnrinde und Hippocampus. Die Veränderungen entwickeln sich über Jahre oder gar Jahrzehnte, bevor sich die ersten klinischen Symptome bemerkbar machen.
Derzeit gewinnen nonmedikamentöse Therapieansätze an Bedeutung
Der Lebensstil entscheidet. „Wir können 35 Prozent der Demenzfälle durch Alzheimer verhindern oder relevant verzögern, wenn wir neun Faktoren beeinflussen”, so Dodel. Je mehr Begleiterkrankungen ein Patient hat, umso schlechter funktionieren die Reparaturmechanismen im Gehirn. Probleme an Herz und Gefäßen befördern Alzheimer. Ein erhöhter Blutdruck im Alter von 36 bis 55 Jahren lässt das Demenzrisiko steigen, ein gut eingestellter Blutdruck verringert es. Ungünstig wirken sich Übergewicht im mittleren Lebensalter und Diabetes aus. Bereits geringfügige Schwerhörigkeit kann einen Abbau kognitiver Fähigkeiten nach sich ziehen.
Wer viel allein ist - mangels Kontakten oder weil er sich aufgrund einer Depression zurückzieht -, hat ein doppelt so hohes Risiko, Alzheimer zu entwickeln wie ein geselliger Mensch. Körperliche Aktivität fördert die Gedächtnisleistung. Hilfreicher als reine Kraftübungen ist dabei ein Training der koordinativen Motorik. Rauchen verursacht Gefäßprobleme und schädigt somit auch das Gehirn.
Die Bildung macht den entscheidenden Unterschied
Je höher das Bildungsniveau und je anspruchsvoller die kognitiven Anforderungen in Beruf und Freizeit, desto besser und länger kann das Gehirn kompensieren”, erläutert Schröder. Fachleute sprechen von „kognitiver Reserve”. Im Laufe des Lebens entsteht durch Bildung und neue Herausforderungen ein anpassungsfähiges neuronales Netzwerk, das die Menschen geistig fit hält und sogar jene Defizite ausgleicht, die durch Eiweißablagerungen entstehen.
Die gängigen Medikamente bei Alzheimer, Cholinesterasehemmer für leichte und mittlere Beschwerden und Memantine für das spätere Stadium, erzielen einen zeitlichen Gewinn von sieben bis zwölf Monaten. Die kognitive Reserve, die man in den frühen und mittleren Lebensjahren aufbaut, scheint durchaus kraftvoller.
Dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen, das ist die Zielrichtung vieler Studien, die derzeit laufen. Mit welchen Verfahren lassen sich Lernprozesse in einem bereits geschädigten Gehirn verbessern? Zu dieser Frage forscht die Neurologin Agnes Flöel am Universitätsklinikum Greifswald. Eine Kombination aus intensivem Gedächtnistraining und Hirnstimulation durch Gleichstrom soll bei Probanden im frühen Krankheitsstadium Gedächtnisleistung und Orientierung fördern.
Life Kinetik Training dient vor allem auch der Demenzvorsorge und Sturzprophylaxe.
Melden Sie sich bei mir für weitere Informationen und zur Kursanmeldung.
Umsetzung statt Inspiration: 3 Tipps, wie du neues Wissen schneller umsetzt
Du bildest dich viel weiter, aber setzt nichts um? Hier erhältst du drei Tipps, wie du Weiterbildung und Umsetzung besser kombinierst und endlich produktiver wirst.
Konstante Weiterbildung ermöglicht es uns, uns immer fortzuentwickeln. Viele Menschen stoßen aber auf ein Problem, wenn es um dieses Thema geht: Es hapert bei ihnen bei der Umsetzung. Dabei ist dies der entscheidende Teil, der dem gelernten Wissen erst einen Wert gibt und dich davon profitieren lässt.
Wieso du vielleicht nicht zum Umsetzen kommst
Weiterbildung fällt vielen leichter als die Umsetzung: Vielleicht liest du gerne viele Bücher, besuchst Online-Kongresse oder Seminare. An dieser Stelle solltest du jedoch bedenken, dass dies alles unter den Aspekt der Inspiration fällt und nicht der Umsetzung zugeordnet werden kann. Inspiration ist zum Beispiel, wenn du brainstormst, dich mit anderen über deine Ideen austauschst oder Videos schaust, von denen du denkst, dass sie dir weiterhelfen. Du kannst dich von vielen anderen Personen absetzen, indem du auf Inspiration immer Umsetzung folgen lässt und auf diese Weise mehr von deinem gelernten Wissen anwendest.
Plane deinen Tag bereits am Vortag
Die meisten Menschen leben eher in den Tag hinein, als in durchzuplanen und ihn wirklich als Chance zu nutzen. High-Performer definieren bereits am Vortag genau, welche Ergebnisse sie am nächsten Tag erreichen wollen. Dadurch wirst du automatisch mehr umsetzen und sogar die Qualität deiner Arbeit erhöhen, weil du nun deinen Fokus nicht auf To-dos, sondern auf Ergebnisse richtest.
Setze auch Ungewohntes um
Es ist leicht, innerhalb der eigenen Komfortzone Wissen umzusetzen. Langfristig gesehen wirst du dadurch zwar Ergebnisse erzielen, dann handelst du jedoch nach dem Minimalprinzip. Der Schlüssel, um mehr umzusetzen und die Qualität der Umsetzung zu erhöhen, ist, außerhalb der Komfortzone nicht nur Wissen aufzunehmen, sondern es auch umzusetzen.
Verständlicherweise fällt das zunächst schwerer, stellt aber sicher, dass du dein Potenzial wirklich ausnutzt. Du kannst beispielsweise jeden Tag eine Sache umsetzen, vor der du dich gerne drückst. Dadurch wirst du nicht nur dein Selbstvertrauen steigern, sondern mehr Ergebnisse in viel geringerer Zeit erzielen.
Priorisiere und verarbeite das Gelernte
Viele Menschen versuchen, Umsetzungstipps anzuwenden, haben aber einen unstrukturierten Weiterbildungsprozess, worunter die Produktivität leidet. Schlussendlich ist der wichtigste Baustein bei der Umsetzung die Verarbeitung des Gelernten.
Beispielsweise bildest du dich durch diesen Artikel weiter. Sobald du fertig mit dem Lesen bist, solltest du das Gelernte aus diesem Artikel strukturieren. Im besten Fall machst du dir dafür schon während dem Lesen Notizen. Wichtig ist, dass du jetzt nicht wahllos umsetzt, sondern erst einmal prüfst, was deine Ziele sind. Im Idealfall ist es dein Ziel, Weiterbildung und Umsetzung so in Einklang zu bringen, dass du letztendlich mehr umsetzt. Vielleicht verbindest du dieses Ziel sogar mit einem konkreten, zu erreichenden Ergebnis.
Sie benötigen weitere Informationen oder Hilfe bei der Umsetzung? Melden Sie sich bei mir für weitere Informationen und einem ersten kostenlosen Coachinggespräch.
4 fixe Tipps gegen Aufschieberitis
Getting things done – nur wie kommen wir denn wirklich ins Tun und die Umsetzung?
Eine kurze Anleitung und Impulse, um ins Tun zu kommen!
Hinterfragen
Um unsere Vorhaben endlich zu verwirklichen, müssen wir zunächst in Klausur gehen und uns selbst mit gnadenloser Ehrlichkeit im stillen Kämmerlein fragen:
Warum vertagen wir immer wieder das Telefonat mit dem Steuerberater oder lassen den Berg an Bügelwäsche weiter wachsen? Wissenden Geistes, dass es mit keinem Tage "besser" wird. Was hält uns wirklich vom Gang ins Fitnessstudio ab und warum haben wir den Keller für Online-Verkäufe immer noch nicht entrümpelt?
Betreiben Sie investigative Ursachenforschung. Nur wer weiß, wovor und warum er hadert, kann den Schalter umlegen. Stark vereinfacht halten uns – Steinzeit bedingt – drei Gründe im Aufschieberitis Modus und der Komfort-Zone fest:
- Angst vor Überanstrengung - aka "Faulheit"
- Angst vor Misserfolg - Scheitern, Fehler
- Angst vor sozialem Ausschluss ("was die anderen wohl denken"), der zu Mammutjagd und Höhlenzeiten den sicheren Tod bedeutet hätte
Visualisieren
Für den nächsten Schritt können Sie mit dem Hintern noch sitzen bleiben. Lediglich Ihr Geist muss kreative Höchstleistungen abrufen, indem Sie sich bildgewaltig, schillernd und siegessicher vorstellen, wie Sie Ihr Ziel bereits erreicht haben.
Visualisieren Sie die tiptop blank geputzte Wohnung, die abgehakte To-do-Liste, die finale Präsentation vor dem Vorstand, die Unterzeichnung des Vertrages oder die neue TÜV-Plakette auf dem Auto. Stellen Sie sich Ihren sportlichen Körper und die bewundernden Blicke am Tresen im Sportclub vor.
Wie fühlen Sie sich, wenn Sie ihr Vorhaben endlich in die Tat gebracht haben?
Versuchen Sie mit allen Sinnen Ihre Zielsituation gedanklich zu manifestieren. Visualisieren hilft uns nicht nur als Ansporn, sondern fungiert auch unserem Unterbewusstsein als dankbare Unterstützung.
Kröten schlucken
Selbst für Veggies: Frösche zum Frühstück sind das beste Mittel im Kampf gegen die Aufschieberitis. Denn das „eat the frog“-Prinzip empfiehlt die wirklich unangenehmen, nervigen oder schwierigsten Aufgaben gleich zu Beginn des Tages zu erledigen.
Aus der Kategorie "ja, da hab ich auch nie Bock drauf": Starten Sie den Tag zu Hause mit den wenig bequemen Liegestützen, wenn Sie wissen, dass Sie andernfalls keine Luft mehr fürs Training finden, der eiskalten Dusche oder der unliebsamen Ablage im Büro. Wenn Sie morgens gleich die dickste Kröte schlucken, kann Ihnen am Tag nicht mehr viel passieren.
Belohnen
Geschafft! Geballte Becker-Faust, Jubel mit Mützen werfen oder wie auch immer Sie Erleicherung, Erfolg und Zielerreichen zeigen!
Nach wochenlangem „ma-mü-ma" (man müsste mal) haben Sie endlich den Wandschrank im Gästezimmer aufgebaut, die Reisekostenabrechnung für das Vorjahr fertig gestellt oder mit der Einkaufsabteilung stapelweise Artikelnummern abgeglichen? Wow!
Beglückwünschen Sie sich! Egal ob mit einem Abstecher ins Lieblingsrestaurant nach Feierabend, einem Shopping-Ausflug in der Mittagspause – was auch immer Sie für angemessen halten – Belohnung muss sein! Niemand anders wird Sie feiern!
Mit der Vorfreude auf Ihre ganz persönlichen „Prämien“ erledigen Sie auch kommende Aufgaben leichtfüßig von den Aufschiebelisten!
Viel Erfolg und Spaß bei der Umsetzung
Lehrerverband bemängelt: Schüler lernen zu wenig über Geld
Schüler lernen aus Sicht von Experten zu wenig über Geldthemen.
„Ökonomische Unterrichtsinhalte spielen in der Schullandschaft eine zu geringe Rolle“, sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, der Nachrichtenagentur dpa. „An vielen Schulen werden sie fachfremd unterrichtet, weil ausgebildete Lehrer dafür fehlen.“
„Finanzbildung als Teil der ökonomischen Grundbildung ist ein wesentlicher Teil der Allgemeinbildung, der erst relativ spät in den Fokus von Schule gerückt ist“, sagte Meidinger. „Dabei ist es ein wichtiger Teil neben Bereichen wie sprachlicher und musischer Bildung. Da gibt es auch heute noch Defizite an deutschen Schulen.“
Auch der Schuldnerberater Frank Wiedenhaupt sieht Handlungsbedarf. „Die Welt ist komplizierter geworden“, sagte das Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung. „Es kommen spürbar immer mehr junge Menschen in die Schuldnerberatungsstellen. Ein häufiger Satz ist dann: ,Hätte ich das doch nur früher gewusst.'“ Wiedenhaupt schlägt vor: „Man könnte im Deutschunterricht ja mal einen Mobilfunkvertrag durchgehen. In Mathe könnte ein Inkassoschreiben durchgegangen werden oder man könnte Zinsberechnungen machen. Oder die Frage stellen, ob ein Prepaid-Handy günstiger ist als ein Vertrag.“
Der Lehrerverbandschef empfiehlt neben Besuchen externer Fachleute im Unterricht Projekte, um ökonomische Aspekte zu veranschaulichen. „Man kann auch Schulfeste oder ein Schülercafé organisieren und dabei lernen, wie man mit der Klasse Geld erwirtschaftet“, sagte Meidinger. Ein Praxisteil zur Vermittlung finanzieller Bildung sei wichtig, sollte aber nicht der Kernteil sein. „Vor allem an weiterführenden Schulen geht es darum, ökonomische Zusammenhänge zu erkennen.“
Aus Sicht von Verbraucherschützerin Vera Fricke sollten Schüler die Fallstricke kennen, die es gibt. „Sie müssen Konsumwünsche reflektieren können und wissen, von welchen Institutionen sie unabhängige Informationen bekommen“, sagte Fricke. Kinder und Jugendliche müssten auch lernen, dass sie als Verbraucher ein Teil des ökonomischen Systems seien. „Finanzielle Bildung ist immens wichtig, gerade da unsere Welt immer stärker aus Konsumgeflechten besteht. Hier spielen die Eltern, aber auch die Schule eine wahnsinnig große Rolle.“ Sie hält einen problemorientierten Ansatz für wichtig. „Die Schüler sollten sich eher mit der Frage auseinandersetzen, wie sie mit dem ihnen zur Verfügung stehenden Geld klarkommen, als damit, wie sie mit Aktien umgehen.“
Der Bereichsleiter Wirtschaft bei der Joachim-Herz-Stiftung, Wolf Prieß, betont: „Es geht um Bildung zur Bewältigung des Lebens, um aufgeklärt einkaufen zu können und Konsum auch kritisch zu sehen. Wichtig ist eine begründete Skepsis, die einen nicht lähmt.“ Schülern müssten die dahinterliegenden ökonomischen Modelle vermittelt werden, um sie in der Wirklichkeit zu reflektieren. Die Stiftung will mit Projekten die ökonomische Bildung von Schülern fördern.
Flexibilität besser trainieren
Flexibilität, Experimentierfreude und Urteilskraft sind die Hard Skills der Zukunft
Immer häufiger ist in den Führungs- und Personaler-Etagen die Rede davon, dass bei der Bewerberauswahl künftig verstärkt auf die sozialen und personalen Fähigkeiten der Mitarbeiter geachtet werden soll. Das bedeutet nicht, dass das reine Fachwissen, wie zum Beispiel IT-Kenntnisse, von heute auf morgen obsolet wird. Klar ist aber auch, dass flexible und veränderungsgewillte Menschen in unserer durchdigitalisierten Arbeitswelt künftig besser zurechtkommen und demnach gefragter sein werden.
Die Gemeinschaftsstudie des Bundesverbands der Personalmanager und des IW Köln „Kompetenzen und digitale Bildung in einer Arbeitswelt 4.0“ bestätigt: Beim Gros der Belegschaft werden insbesondere soziale und personale Kompetenzen vorausgesetzt. Konkret ist es für die breite Mehrheit der befragten HR-Manager insgesamt sehr wichtig, dass ein Großteil ihrer Mitarbeiter über berufliches Fachwissen (86 Prozent), aber auch Veränderungsbereitschaft und Flexibilität (85 Prozent) verfügt.
Die größte Lücke zeigt sich tatsächlich bei der sozialen Kompetenz, und zwar im Bereich der Veränderungsbereitschaft und Flexibilität, also genau den zentralen Fähigkeiten, die jeder Personaler und Topmanager derzeit von allen Bühnen predigt. Klar ist: Die Bedeutung dieser Kompetenzen wird wichtiger.
Flexibilität schlägt Datenkenntnisse
In Zukunft wird es darauf ankommen: flexibel und häufig unvorbereitet neue Wege oder Arbeitsweisen beurteilen und damit adaptieren zu können. Flexibilität und Veränderungsbereitschaft werden die Bedeutung von Datenkenntnissen schlagen. Denn was nutzt mir der beste Data-Scientist, wenn er nicht über die Auswirkungen oder Chancen der Datensätze für seinen Arbeitgeber urteilen kann?
Genau genommen muss man schon in der Schule ansetzen. Unser Bildungssystem entlässt die Abgänger mit einer hohen Fachlichkeit ins Berufsleben. Es wäre aber zudem wichtig, dass sie parallel über die Jahre der Ausbildung ihre Kompetenzen im Bereich Urteilskraft, Anpassungsfähigkeit oder Veränderungsbereitschaft schärfen konnten. In der Praxis sollten Schüler ihr einmal angeeignetes fachliches Wissen je nach Kontext prüfen oder hinterfragen. Die Annahme, dass alles einmal Erlernte für lange Zeit Bestand hat, macht viele Menschen im Job unflexibel. Viele hochqualifizierte Menschen, die jetzt einen Arbeitsplatzverlust fürchten, haben eben genau diese Flexibilität niemals wirklich erlernt. Die Folge: Sie fühlen sich überfordert und könnten demnächst in der Wirtschaft sukzessive aussortiert werden.
Mitarbeiter sollten improvisieren dürfen
Unternehmen müssen keine großen Programme aufsetzen. Stattdessen sollte jede Führungskraft zunächst in eine Art Experimentierphase mit ihren Mitarbeitern gehen, um zu erfahren, wie diese mit mehr Freiraum und Eigenverantwortung beispielsweise in Projekten klarkommen. Das fördert die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein des Einzelnen, denn jeder Mensch hat seine ganz eigene Art und Weise, an Neues heranzugehen. Diese Zeit sollten sich beide Seiten trotz der hohen Veränderungsdynamik nehmen, um sicherzugehen, wie es wirklich um das flexible Einlassen auf Neues bestellt ist.
Wichtig dabei: Die Führungskraft sollte zuvor einen klar abgesteckten Rahmen vorgeben und Ziele definieren, aber den möglicherweise ungewohnten Weg der Umsetzung komplett dem Mitarbeiter überlassen. Nach dieser ersten Experimentierphase kann der Vorgesetzte meist deutlich erkennen, wie es um die Bereitschaft zur Flexibilität des Mitarbeiters bestellt ist. Sollte er sich damit unwohl oder überfordert fühlen, tut der Personaler gut daran, ihn für einen festgesteckten Arbeitsbereich mit marginalen Veränderungen vorzusehen.
Nehmen wir das Beispiel des Umgangs mit einer neuen Technologie. Zuerst muss der Mitarbeiter verstehen, wie diese Technologie für seinen Arbeitsbereich oder sein Unternehmen funktioniert, welche Anwendungsvorteile sie bringt. Dann wird er an den Punkt kommen, darüber nachzudenken, ob und in welchen Situationen sie überhaupt sinnvoll eingesetzt werden kann – und wann sie womöglich die Zusammenarbeit unnötig verkompliziert. In solchen Momenten werden Mitarbeiter damit konfrontiert, stärker als bisher Konflikte oder auch Kompromisse einzugehen. Denn es geht in der Situation darum, die eigene Urteils- und Entscheidungskraft auf Basis sich stets weiterentwickelnder Technologien zu schärfen.
Mittels Life Kinetik Training und Coaching kann ich auch Ihnen dabei behilflich sein, geistig flexibler zu werden und damit besser gerüstet für die berufliche Zukunft zu sein.
Melden Sie sich bei mir für weitere Informationen.
Doppelt so viele Schüler wie 2017 haben Förderbedarf
In zwei Jahren stieg die Zahl der Anträge von 347 auf 646 in Wuppertal. Dem erhöhten Bedarf steht ein erheblicher Mangel an Sonderpädagogen gegenüber.
Immer häufiger müssen Experten prüfen, ob Kinder eine besondere Unterstützung brauchen – weil ihnen das Lernen schwer fällt, sie emotional und sozial auffällig sind, körperliche und motorische Entwicklungsdefizite haben. Im Schulausschuss wurden die Zahlen aus den Schuljahren 2016/17, 2017/18 und 2018/19 vorgelegt. Sie zeigen, dass die Anträge auf eine solche Untersuchung in dieser Zeit von 347 auf 646 gestiegen sind.
Einen besonders großen Anstieg gab es bei Anträgen im Bereich „Lernen“: von 89 auf 188. Im Bereich „Emotionale und soziale Entwicklung“ stieg die Zahl der Anträge von 55 auf 96, im Bereiche „Geistige Entwicklung“ von 36 auf 55, bei „Sprache“ von 33 auf 41. Die meisten der Anträge führen offenbar auch zur Feststellung eines Bedarfs, denn abgelehnt wurden pro Jahr nur wenige Anträge. Allerdings stieg auch die Zahl der Anträge eklatant, die zum Ende des Schuljahres noch nicht entschieden sind: von 19 auf 187 – sie hat sich mehr als verzehnfacht.
Auch landesweit steigt die Zahl der Kinder mit Unterstützungsbedarf, aber nicht so stark wie in Wuppertal. 2009 wurden in NRW knapp 130 000 solcher Kinder gezählt, das machte 4,6 Prozent aller Schülerinnen und Schüler aus. 2018 waren es fast 147 000, das sind 5,9 Prozent aller Schulkinder im Land.
Haben Eltern oder Lehrer den Eindruck, dass ein Kind Unterstützungsbedarf hat, können die Eltern einen Antrag auf Prüfung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs stellen. Ein externer Sonderpädagoge oder eine Sonderpädagogin begutachtet dann das Kind durch Beobachtung im Unterricht, im Gespräch oder durch Tests. Ihr Gutachten wird im Schulamt geprüft. Wird ein Bedarf festgestellt, können die Eltern entscheiden, ob das Kind an der Schule bleibt – wenn es eine Schule des gemeinsamen Lernens ist – oder ob das Kind auf eine Förderschule wechselt.
Es fehlt das Personal, das sich um die Kinder kümmern kann
Das Thema Sonderpädagogen ist auch das Problem. Denn diese werden gebraucht, um sich um die Kinder mit Unterstützungsbedarf zu kümmern. Überall fehlen sie, sowohl an den Regelschulen des gemeinsamen Lernens als auch an den Förderschulen. Und es fehlen Bewerber für die unbesetzten Stellen.
Schneller und einfacher lernen mit Life Kinetik. Das Training steigert die Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit. Melden Sie sich bei mir für weitere Informationen und zur Kursanmeldung.
Pisa-Ergebnisse - Wieder nichts gelernt
Nur Mittelmaß. Bei der Pisa-Studie bleiben die Schülerleistungen hierzulande hinter Deutschlands Ansprüchen zurück. Die Versager sitzen aber nicht in der Schule.
Deutschland, ein Dreier-Kandidat: Bei der neuen Pisa-Studie fällt das Zeugnis für die Schülerinnen und Schüler hierzulande gemischt aus. Sie haben sich etwas verschlechtert, liegen aber über dem OECD-Schnitt. Da wünscht sich mancher mehr Ehrgeiz, bezeichnenderweise zum Beispiel Bildungsministerin Anja Karliczek. Das eigentliche Desaster ist aber gar nicht Deutschlands Dümpeln im oberen Mittelfeld, sondern die Bildungskatastrophe, die hinter den Pisa-Zahlen steckt.
Die Leistungsschere der 15-Jährigen reißt immer weiter auf. Deutschland hat mehr Einser-Schüler und mehr Fünfer-Kandidaten als im OECD-Schnitt - und zusammen erreichen sie Mittelmaß. Beispiel Lesekompetenz: Jeder fünfte Schüler hat große Mühe, Texte zu lesen und zu verstehen, geschweige denn "Fake News" im Internet zu erkennen. An Schulen, die kein Gymnasium sind, ist es sogar fast jeder Dritte. Tendenz steigend. Gleichzeitig ist der Anteil der hochkompetenten Leser gestiegen, besonders an Gymnasien. Wie gut Jugendliche lesen können, hängt zudem - wie der Schulerfolg insgesamt - beträchtlich von der sozialen Herkunft ab. Ein Dauerbefund in den Pisa-Studien. Dieser Zusammenhang hat sich sogar verstärkt. Die meisten anderen OECD-Länder bekommen das weitaus besser hin.
Das Erschreckende: Diese Befunde sind nicht neu, sondern offenbaren eine unerträgliche politische Ignoranz und mangelnde Wertschätzung der Kinder und Jugendlichen in diesem Land. Obwohl die Politik seit fast 20 Jahren um die Missstände weiß, unternimmt sie nur hier und da halbherzige Reparaturarbeiten, so dass weiter viel zu viele Menschen auf der Strecke bleiben.
Das fängt schon in der Kita an. Der bundesweite Kita-Ausbau sollte eine frühzeitige Förderung ermöglichen, unabhängig vom Elterenhaus. Aber die Nachfrage ist in vielen Regionen größer als das Angebot, und da ergattern bildungsbürgerliche, berufstätige Eltern auch wegen politischer Regularien oft eher einen Ganztagsplatz als sozial benachteiligte oder zugewanderte Familien. Dabei bräuchten deren Kinder die Förderung besonders dringend, um später in der Schule gut mitzukommen. Einem Kind die deutsche Sprache beizubringen, ist einfach, wenn Kitas personell gut ausgestattet sind. Doch gerade daran hapert es vielerorts, auch weil die Arbeit von der Politik über Jahre nicht richtig ernst genommen wurde.
In den Schulen werden weitere Chancen verpasst. Der Ausbau von Ganztagsschulen sollte Chancengerechtigkeit fördern. Aber bis heute kommt dieser Ausbau in einigen Bundesländern nur äußerst schleppend voran. Die Große Koalition hat zwar einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab 2025 festgelegt und will Milliarden zuschießen. Aber Fachleute sind sich einig, dass die Summe bei Weitem nicht reicht. Die Gelder sollen zudem erst fließen, wenn sich Bund und Länder geeinigt haben, wer was beisteuert. Das kann dauern. Wie schwer sich Deutschlands Bildungsminister tun, überhaupt an einem Strang zu ziehen, überall vergleichbare Bedingungen zu schaffen, hat zuletzt der Streit um den Nationalen Bildungsrat gezeigt.
Als geradezu chancenlos gilt da die Abschaffung der Gymnasien. Dabei sind sich viele Fachleute einig, dass bei der Selektion nach der Grundschule nicht nur gute Noten zählen, sondern auch die soziale Herkunft. Und dass die Chancengerechtigkeit stiege, wenn Kinder flächendeckend länger zusammen lernten - so wie in fast allen anderen Ländern auch. Stattdessen schiebt die deutsche Politik fast nur den nicht-gymnasialen Schulen Aufgaben wie Inklusion oder die Aufnahme geflüchteter Schüler zu, und zwar viel zu oft ohne die nötige Ausstattung. Ausgerechnet Schulen in Problemvierteln sind davon besonders betroffen. Sie leiden stärker unter Deutschlands Lehrermangel als andere. Mindestens das müsste sich dringend ändern.
Alles andere ist nicht nur ungerecht, sondern auch riskant. Wenn die Gesellschaft schon bei den 15-Jährigen in Deutschlands Schulen so auseinanderdriftet, wie soll sie dann unter Erwachsenen wieder zusammenfinden?
Das Life Kinetik Training kann auch als Lernhilfe genutzt werden.
Hier wird nicht nur ein Fach bearbeitet, sondern alle Bereiche des Lernens verbessert.
Melden Sie sich bei mir für weitere Informationen und zur Kursanmeldung.
Wie Jammern Dein Gehirn verändert (und Dich immer negativer macht)
Ach, ich hab es schwer. Aber ich bin nicht bereit, mein Elend alleine auszusitzen, deswegen kommt der Kollege in der Büroküche wie gerufen. Ich hole gerade Luft, da ist der Kollege schneller: Mensch, was hat er es momentan schwer. Seine jüngste Tochter zahnt, an Schlaf ist nicht zu denken. Dann hat ihm irgend so ein Idiot heute früh den Parkplatz weggeschnappt. Und überhaupt…
Tatsächlich dachte ich immer, Jammern sei gesund. Lass Deinen Frust raus. Friss nichts in Dich rein. Dabei ist Jammern überhaupt nicht gesund, wie die Wissenschaft inzwischen herausgefunden hat.
Jammern wird schnell zur Gewohnheit
Das Gehirn mag es simpel. Es will effizient arbeiten und sich unnötigen Aufwand sparen. Also legt es gerne Muster an, die später bei ähnlichen Situationen einfach wieder abgerufen werden. So entstehen Gewohnheiten. Nur ein paar Mal morgens aufgestanden, aus dem Fenster geschaut und übers Wetter geschimpft, und prompt speichert mein Gehirn ein Muster ab: Morgens aufstehen = Scheiß Wetter!
Beim nächsten Mal stehe ich morgens auf und hab schon „Scheiß Wetter!“ gerufen, bevor ich überhaupt aus dem Fenster geschaut habe (ist natürlich besonders tragisch, wenn ausgerechnet an diesem Tag die Sonne scheint). Und so geht das schlimmstenfalls weiter, bis ich eines Tages mit 80 im Schaukelstuhl sitze und meinen Enkelkindern von einem Leben unter durchweg schlechtesten Wetterbedingungen erzähle.
Laut Psychologe Jeffrey Lohr von der Arkansas University bleibt es aber nicht bei meiner Wetter-Aversion. Ich habe meinem Gehirn damit lediglich die Grundrichtung vorgegeben. Nach einiger Zeit im Jammer-Modus sind meine Neuronen so vernetzt, dass meine Gedanken automatisch die negative Richtung einschlagen – egal, worum es geht.
Oft fällt uns das aber viel eher bei anderen auf als bei uns selbst. Diese eine Freundin, die immer nur alles schwarzmalt. Der Chef, der aber auch immer was zu kacken hat. Mein Gott, wie die nerven mit ihrem ständigen Genöle! Und manchmal manipulieren sie uns damit sogar. Der Hamburger Psychologe Michael Thiel sagt: „Menschen, die jammern, müssen nicht immer die Schwachen sein. Hier werden oft andere für die eigene Unzufriedenheit verantwortlich gemacht.“
Jammern macht vergesslich
Eine Studie der Stanford University belegt, dass Jammern einen Teil des Gehirns schrumpfen lässt: den Hippocampus. Der gehört zum limbischen System und ist für das Gedächtnis zuständig. Ewiges Jammern fördert also die Vergesslichkeit. Klingt im ersten Moment vielleicht nicht so schlimm. Bis man sich bewusst macht, dass der Hippocampus auch zu den ersten Regionen gehört, die bei einer Alzheimererkrankung geschädigt werden.
Jammern bedeutet Stress
Wir jammern nicht grundlos, irgendetwas hat uns geärgert, traurig oder wütend gemacht. Ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber wenn ich mich ärgere, dann bin ich selten entspannt dabei. Mein Herz rast. Meine Schläfen pochen. Ich bin unruhig und fahrig, als hätte ich eine Kanne Kaffee auf Ex gekippt. Der Grund: Wenn das Gehirn negative Emotionen wie Wut oder Ärger verarbeitet, gibt es Alarmsignale an den Körper weiter. Das Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet. Ein dauerhaft zu hoher Cortisol-Pegel soll das Risiko von Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Diabetes und Depressionen erhöhen.
Auswege aus dem Jammertal
Anstatt im Dauer-Modus zu jammern, lass uns dankbar sein. Für all die kleinen und großen Dinge in unserem Leben, die uns keinen Grund zu klagen geben. Dann regnet es eben an diesem Morgen, na und? Dafür wache ich in einem schönen Zuhause auf, habe ein gutes Kind – und nebenbei bemerkt ja auch noch einen Regenschirm. So polen wir unser Gehirn von negativ sofort (aber auch dauerhaft) zurück auf positiv.
Allein durch Dankbarkeit sinkt der Cortisolpegel nachgewiesenermaßen um 23%, wie die University of California in Davis bei ihren Nachforschungen herausgefunden hat. Bessere Laune, mehr Energie und weniger Stress – im Gegensatz zur „chronischen Jammeritis“ sind doch „Nebenwirkungen“, mit denen es sich gut leben lässt, oder?
Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung um aus dem Jammertal zu kommen? Melden Sie sich bei mir für weitere Informationen und einem ersten kostenlosen Coachinggespräch.
Bevölkerung bewegt sich in Corona-Krise weniger
Laut einer repräsentativen Umfrage ist mehr als ein Drittel der Erwachsenen seit dem Lockdown körperlich weniger aktiv als zuvor. Stattdessen steigt der Medienkonsum.
Als sich die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in den vergangenen Wochen nach und nach verschärften, stieg auch die Zahl der Jogging-Ratgeber rapide an. Wenn schon so gut wie alle anderen Aktivitäten untersagt seien, so der Tenor, könnte die Corona-Krise doch wenigstens dazu führen, liegengebliebene gute Vorsätze in die Tat umzusetzen und endlich mit dem Laufen anzufangen. Aber, wie das so ist mit hehren Zielen, sie sind um einiges leichter zu formulieren als zu erfüllen.
Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur legt nun sogar nahe, dass Home-Office und Kontaktbeschränkungen in Deutschland nicht zu mehr, sondern zu weniger sportlicher Betätigung geführt haben. Demnach gaben 38 Prozent der befragten Erwachsenen an, sich weniger zu bewegen, 19 Prozent haben bereits an Gewicht zugelegt. Am meisten scheint die Gruppe der 35- bis 44-Jährigen unter dem Lockdown zu leiden, hier erklärten 25 Prozent der Befragten, zugenommen zu haben. Zu positiven Veränderungen kam es nur bei einem kleinen Teil der Menschen: Zwölf Prozent der Befragten sagten, sie bewegten sich seit den Corona-Maßnahmen mehr als zuvor, acht Prozent haben abgenommen.
Ein langfristiger Mangel an Bewegung kann gesundheitliche Folgen haben. Laut der Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Heidrun Thaiss, steigt bei Übergewicht etwa das Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Gelenkprobleme. Die YouGov-Studie zeigt auch auf, in welchen anderen Bereichen sich das Verhalten der Bevölkerung in Deutschland während des Lockdowns verändert hat. So geben 13 Prozent der Befragten an, sie äßen in Zeiten von Corona gesünder als zuvor, beinahe ebenso viele, nämlich zwölf Prozent, stellten allerdings das Gegenteil fest. Gleichzeitig bietet die Erhebung einen Hinweis darauf, was die Menschen mit ihrer Zeit anfangen. So gaben 39 Prozent der Befragten an, einen größeren Teil ihrer Freizeit vor elektronischen Geräten zu verbringen. Spitzenreiter ist dabei die Bevölkerungsgruppe zwischen 18 und 24 Jahren. Unter ihnen sagen 60 Prozent, dass sie länger als gewöhnlich vor dem Fernseher, dem Rechner oder der Spielekonsole sitzen.
Life Kinetik Training ist leichte und lockere Bewegung für alle Altersklassen
bei dem neben dem Körper auch gleich das Gehirn trainiert wird.
Melden Sie sich bei mir für weitere Informationen und zur Kursanmeldung.
Logisches Denken ist erlernbar
Ein psychologisches Modell zur Definition von Intelligenz geht auf den britisch-amerikanischen Psychologen Raymond Cattell zurück. Dem zufolge gibt es zwei Faktoren der generellen Intelligenz, die kristalline Intelligenz und die fluide Intelligenz.
Kristalline Intelligenz
Mit kristalliner Intelligenz lässt sich das Faktenwissen beschreiben, das der Mensch sich im Laufe seines Lebens aneignet. Dazu gehört erworbenes Wissen wie Vokabeln lernen ebenso wie das Wissen um die korrekte Anwendung von erworbenen Wissen, so beispielsweise Fahrradfahren oder auch herausgefundene Wege zur Problemlösung. Die kristalline Intelligenz wird als stark sozialisations- und kulturabhängig bezeichnet.
Fluide Intelligenz
Fluide Intelligenz, auch fluides Denken genannt, beschreibt die Fähigkeit zu logischem und abstraktem Denken ungeachtet bereits bestehender Erfahrungen. Man geht davon aus, dass die fluide Intelligenz genetisch bedingt ist und ab einem Alter von 25 Jahren abnimmt. Fluide Intelligenz zeigt sich darin, wie schnell sich ein Mensch in neuen Situationen zurechtfindet und anpasst. Ebenfalls zählt dazu die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Sie ist typisch für kleine Kinder, die beispielsweise mühelos Fremdsprachen erlernen.
Kristalline und fluide Intelligenz in Kombination
Da die fluide Intelligenz zu einem gewissen Grad angeboren zu sein scheint, bildet sie die Grundlage für die kristalline Intelligenz, beide Formen der Intelligenz hängen also zusammen.
Ein gutes Ausdrucksvermögen, Fachwissen und soziale Kompetenz gehen auf das kristalline Denken zurück, während die fluide Intelligenz vor allem für die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Informationsverarbeitung steht. So lernen Kinder ja nicht nur Sprachen, sondern auch den Umgang mit technischen Geräten weitaus schneller und spielerischer als Erwachsene.
Die fluide Intelligenz ermöglicht die Aneignung von Wissen, die kristalline Intelligenz verknüpft dieses Wissen zu Erfahrung. Mit Erfahrung lässt sich wiederum der Abbau von fluider Intelligenz ausgleichen.
Kann fluide Intelligenz trainiert werden?
Besonders der präfrontale Cortex und der Scheitellappen stehen mit fluider Intelligenz in Verbindung. Das Gehirn ist in jungen Jahren plastischer. Diese Plastizität des Gehirns nimmt ab etwa Mitte zwanzig messbar ab und damit auch die fluide Intelligenz.
Da diese Bereiche vom altersbedingten Abbau betroffen sind, erklärt sich einmal mehr, warum Kinder und Jugendliche eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit haben. Allerdings ist dies kein Grund zur Panik:
- Erstens ist fluide Intelligenz nur eine Form der Intelligenz.
- Zweitens lässt sie sich Untersuchungen zufolge steigern.
- Drittens können Sie mit der kristallinen Intelligenz kompensieren.
Die Schweizer Neuropsychologin Susanne Jaeggi fand in Studien heraus, dass fluide Intelligenz trainierbar ist. Zwar ist sie genetisch vorbestimmt, aber lediglich zu 40 Prozent. Das heißt satte 60 Prozent, also mehr als die Hälfte, lassen sich trainieren.
Genau genommen geht es bei fluider Intelligenz um das Arbeitsgedächtnis, welches dafür zuständig ist, Informationen kurzfristig zu speichern und zu verarbeiten. Wir benutzen das Arbeitsgedächtnis, wenn wir uns Telefonnummern merken oder ein Spiel spielen. Je schneller es funktioniert und möglichst viele Informationen gleichzeitig speichern kann, umso besser.
Typischerweise haben Physiker, Mathematiker und Hochbegabte ein besonders schnelles Arbeitsgedächtnis. Andererseits gibt es sehr gebildete Menschen mit einem hohen Wissen, die Schwierigkeiten haben, sich in ungewohnten Situationen zurecht zu finden – die fluide Intelligenz ist hier geringer ausgeprägt.
So können Sie Ihre Intelligenz trainieren
Es spricht einiges dafür, dass ein Training des Arbeitszeitgedächtnisses, in dem Informationen kurzfristig bereitgehalten werden, sich positiv auf die fluide Intelligenz auswirkt. Auch ist bekannt, dass Stress und äußere Einflüsse wie hoher Alkoholkonsum sich negativ auf das Gehirn auswirken – indem Sie solche Faktoren berücksichtigen, wirken Sie dem Abbau bereits entgegen.
Dazu haben verschiedene Untersuchungen zweifelsfrei belegen können, dass kontinuierliches Lernen geistig fit hält und vor Krankheiten wie Alzheimer schützen kann. Wichtig dafür sind Übungen, die auditive, visuell-räumliche und verbale Wahrnehmung und Fähigkeiten trainieren. Wie geht das?
Vielseitigkeit beachten
Suchen Sie sich Knobelaufgaben, die Ihnen Spaß machen. Sie werden sich ohnehin beim Gedächtnistraining nicht motivieren können, wenn Sie das Gefühl haben, alles aus einem Zwang heraus zu machen. Da es eine Vielzahl an Möglichkeiten wie etwa Sudoku-Rätsel und Gehirnjogging gibt, ist für jeden etwas dabei. Idealerweise sollten unterschiedliche Aufgaben miteinander verbunden sein, so dass beispielsweise nicht einseitig ein Zahlenverständnis trainiert wird, sondern der Wortschatz und eine schnellere Auffassungsgabe ebenso. Textaufgaben in der Mathematik können hier hilfreich sein. Trainiert werden meist Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Zahlengedächtnis und Sprachverständnis.
Gesundheit fördern
Es stimmt: Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Intelligente Menschen verhalten sich rücksichtsvoller und gesünder ihrem Körper gegenüber. Studien zufolge trinken sie weniger Alkohol, rauchen seltener, sind sportlich aktiver und achten stärker auf eine ausgewogene Ernährung. Infolgedessen erkrankten sie seltener an Herz- und Lungenkrankheiten oder Magen-Darm-Erkrankungen. Selbst bei Autounfällen kamen sie seltener ums Leben.
Eigenheit berücksichtigen
Was auch immer Sie konkret trainieren, es ist wie mit einem Muskel im Fitnessstudio: Sie müssen sich natürlich gerade am Anfang an Ihrem persönlichen Niveau orientieren. Wer nie Gewichttraining gemacht hat, kann nicht plötzlich 100 Kilo wie nichts stemmen. Es geht darum, den goldenen Mittelweg zwischen Überforderung und Unterforderung zu finden und dann langsam zu steigern.
Bewegung einbauen
Sport hat nachweislich einen positiven Einfluss auf die Gehirntätigkeiten. Kein Wunder: Alles wird durchblutet und mit Sauerstoff versorgt, Stress abgebaut, Glückshormone ausgeschüttet. Derart entspannt sind Sie hinterher umso aufnahmefähiger. Gleichzeitig trainieren Sie bei bestimmten Sportarten Schnelligkeit, Ausdauer und Reflexe. Nun hat Sport oftmals einen Leistungscharakter. Es geht aber auch deutlich spielerischer: Tanzen lernen macht ebenfalls intelligent! Sie werden dadurch nicht nur fitter, sondern trainieren Ihre Aufmerksamkeit und Reaktionsschnelligkeit.
Abwechslung hineinbringen
Routine ist in bestimmten Bereichen zwar vorteilhaft, weil Sie dann bestimmte Übungen verbessern. Ihnen sollte es allerdings darum gehen, viele verschiedene Gehirnareale miteinander zu verknüpfen. Das passiert durch ungewöhnliche, neue Wege. Statt in Routinen festzustecken, soll man lieber häufiger seine Gewohnheiten ändern, beispielsweise einfach mal einen anderen Weg zur Arbeit fahren als bisher und somit neue Anreize für das Gehirn schaffen. Solche Tricks tragen bereits dazu bei, dass die fluide Intelligenz weniger schnell abnimmt.
Mit Life Kinetik trainieren Sie Ihr Arbeitsgedächnis um die fluide Intelligenz zu steigern und nebenbei sind Sie in Bewegung, führen abwechslungsreiche Übungen aus, trainieren aufbauend auf Ihrem jeweiligen Level und fördern Ihre Gesundheit.
Melden Sie sich bei mir für weitere Informationen und zur Kursanmeldung.
Sobald sich die Situation wieder bessert und es für mich wieder möglich ist, weitere Kurse anzubieten, finden Sie die Termine hier.